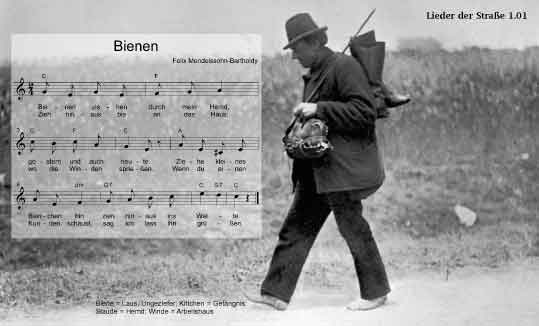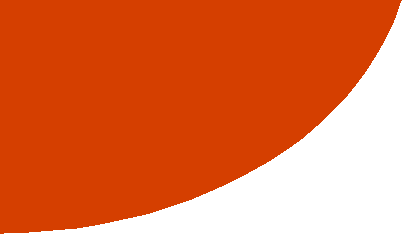„Lobhudeleien“
oder
„zur Sau gemacht“
Es schrieb zu: Werner Hinze, „Hier
hat man täglich seine Noth“ - Auswandererlieder
admarginem – Randbemerkungen zur
Musikalischen Volkskunde. Mitteilungen
des Instituts für Musikalische Volkskunde der
Universität zu Köln, 81 – 2009 (erschienen im
Juni 2010), S. 20-23
Die vorliegende Publikation setzt die
Reihe der von Werner Hinze veröffentlichten, in ad marginem bereits
rezensierten Liederbüchern mit Lexikonteil fort:
„Lieder der Straße“ (2002; vgl. ad marginem
76/2004), „Seemanns Braut
is’ die See. Lieder, Gedichte
und vertellen zwischen Seefahrt und Kiez“ (2004; vgl. ad marginem 77/2005)
und „Notensalat und Geilwurz. Lieder der Küche und
küchenlieder“ (vgl. ad marginem 78/79/2006/07).
Erzwungene Wanderungsbewegungen in Europa
gab es verstärkt seit dem 15. Jahrhundert, als die
Sephardim und Mauren aus Spanien vertrieben wurden. Seit dem
Ende des 16. Jahrhunderts verließen viele Menschen ihre
Heimat aus konfessionellen Gründen, denn es galt in und
außerhalb von Deutschland das Prinzip cuius regio eius religio: Wer
nicht zur Konfession seines Landesherrn übertreten wollte,
musste das Land verlassen. In der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts emigrierten viele Deutsche freiwillig nach Polen,
Rumänien, Ungarn und Russland, nachdem die dortige
Obrigkeit zur Einwanderung aufgerufen hatte. So lockte etwa die
russische Zarin Katharina ((. Siedlungswillige, indem sie ihnen
zahlreiche Privilegien einräumte. Als diese später
zum Teil aufgehoben wurden, erfolgte eine Auswanderungswelle
nach Übersee, insbesondere nach Brasilien
Seit 1816, dem Ende der Napoleonischen
Kriege, bis 1932 gingen mehr als 60 Millionen Europäer
nach Übersee, darunter etwa sieben Millionen Deutsche.
Weit über die Hälfte von ihnen nach Nordamerika auf.
Gründe für die damaligen Massenauswanderungen waren
Hungersnöte, wirtschaftliche Krisen, Arbeitslosigkeit und
politische Unterdrückung. Nach der Niederschlagung der
Revolution von 1848 verließen Zehntausende von Bauern,
Handwerkern, Arbeitern und Intellektuellen Deutschland. In
diesem politischen Zusammenhang entstanden u. a. die
„Texanischen Lieder“ von August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben, die teilweise in die vorliegende Sammlung
aufgenommen wurden. Hoffmann von Fallersleben (1798 –
1874) war 1842 aus politischen Gründen seines Amtes
enthoben und des Landes verwiesen worden und hatte zeitweilig
Emigrationspläne, die er aber nicht realisierte.
Im Zusammenhang mit der Auswanderung
entstanden zahlreiche Lieder, denen Hinze für die
vorliegende Sammlung ca. fünfzig aus dem Zeitraum vom 18.
bis ins 20. Jahrhundert auswählte. Ein großer Teil
davon findet sich im Deutschen Volksliedarchiv Freiburg, dessen
Mitarbeiterin Waltraud Linder-Beroud u. a. zahlreiche
Liedkommentare verfasste. Zu vielen Liedtexten fehlen die
Melodien; man kann jedoch davon ausgehen, dass die meisten von
ihnen zu damals populären Weisen gesungen wurden. Da Hinze
daran gelegen ist, die – zum Teil in Vergessenheit
geratenen – Lieder der gegenwärtigen Praxis
zugänglich zu machen, wurden sämtliche Texte mit
traditionellen Melodien versehen, manchmal in bearbeiteter und
ergänzter Version. Einige wenige Melodien sind
Neuschöpfungen im traditionellen Stil (z. B. „O
hört die traurige Geschichte“, S. 28f.) Damit die
Lieder nicht nur gelesen, sondern auch gespielt und gesungen
werden, hat der Herausgeber den Melodien Akkordsymbole
hinzugefügt.
Viele Liedtexte nennen
unmissverständlich die Gründe für den Entschluss
auszuwandern: „In Deutschland herrscht so große
Not, hier hat man kaum ein Stückchen Brot“ (S. 38).
Der Misere in der „alten Welt“ setzen sie ein
besseres Leben in der „neuen Welt“ entgegen. Aus
der Ferne erschienen vor allem die Vereinigten Staaten von
Amerika, Hauptziel der Auswandererströme, als ein
Schlaraffenland („In Amerika, da ist es fein, da
fließt der Wein zum Fenster rein“, S. 38). Mit den
fernen Zielen verbanden sich oftmals utopische Vorstellungen,
so dass Enttäuschungen programmiert waren. Der
optimistische Zug vieler Lieder hing jedoch auch mit ihrer
Funktion zusammen, sich Mut zu machen und Angst und
Abschiedsschmerz zeitweilig zu übertönen. Denn
Auswanderung bedeutete in früheren Zeiten oft die
endgültige Trennung von den Angehörigen und Freunden
in der alten Heimat und war somit durchaus vergleichbar mit
deren Tod. In manchen Fällen stammen euphorische
Schilderungen aber auch von Auswanderungsagenten, die das Leben
in Übersee aus kommerziellen Interessen anpriesen.
Andere Liedtexte betonen
demgegebenüber die negativen Aspekte der Auswanderung,
indem sie – teils übersteigert – das Elend und
die Gefahren der Überfahrt und die Enttäuschungen in
der Fremde thematisieren. Solche negativen Darstellungen
dienten manchmal der Propaganda derer, denen daran gelegen war,
die Abwanderung einzudämmen oder zu verhindern. So
schürt z. B. das Lied „Ein stolzes Schiff“,
das dem Leser bereits aus Hinzes Sammlung „Lieder der
Straße“ bekannt ist, Ängste gegenüber
Amerika (S. 72): „Unter’m fremden, weiten
Himmelbogen erwartet sie ein neues Schicksal dann: Elend, Armut
und Kummer wiegt sie gar oft in Schlummer.“ Der neative
Aspekt der Auswanderung beherrschte vor allem den
Bänkelsang, der tatsächliche oder vermeintliche
Gefahren der Fremde, Überfälle, Schiffbruch,
materielle Not in der neuen Welt und den Tod in der Fremde an
extremen Einzelbeispielen gern drastisch schilderte –
darin vergleichbar den Sensationsmeldungen der heutigen Yellow
Press.
Hinze intensiviert auch in diesem Band die
Wirkung der Lieder, indem er sie durch weitere historische
Dokumente ergänzt. Einen Einblick in die Schwierigkeiten
der Auswanderung und die Strapazen der weiten Schiffsreise
vermitteln Auszüge aus dem Bericht des Arztes und
Schriftstellers Franz Ennemoser aus dem Jahr 1856, der von
Mainz über Köln. Paris und Le Havre nach Nordamerika
reiste. Er nennt die Gründe der Emigration und gibt
Auswanderungswilligen für ihre Reisevorbereitungen
praktische Ratschläge. Schonungslos schildert er die
Strapazen und Risiken der Reise: die überfüllten
Schiffe, auf denen sich ansteckende Krankheiten schnell
verbreiteten, das Ausgeliefertsein auf hoher See und
schließlich die ernüchternde Realität im zuvor
gelobten Land. Ennemoser selbst kehrt nach dem Tod seiner Frau
und eines seiner Kinder in den USA resigniert nach Deutschland
zurück. Andere Emigranten erreichten nicht einmal ihr
Ziel, ihnen wurde u. a. wegen Krankheit und Mittellosigkeit die
Einreise verweigert und sie mussten nach Hause
zurückkehren, wo man ihnen oft mit Schadenfreude und Spott
begegnete.
Der lexikalische Teil dieses Bandes
enthält – wie auch in den anderen
Veröffentlichungen dieser Reihe – nicht nur
aufschlussreiche Kommentare zu den einzelnen Liedern, sondern
auch Stickwörter zu deren Kontext und ihrer
Entstehungssituation sowie Begriffserläuterungen, die das
Verständnis der Lieder fördern; außerdem
weitere zur Thematik passende Lieder, Gedichte, historische
Dokumente und zahlreiche Abbildungen. Aus allem fügt sich
ein sehr anschauliches, vielseitiges und anregendes Bild vom
Leben in vergangenen Zeiten zusammen. Manchmal wäre ein
alphabetisches Register der Liedanfänge, das die Namen der
Autoren nennt, bei der Lektüre hilfreich.
Dr. Gisela Probst-Effah