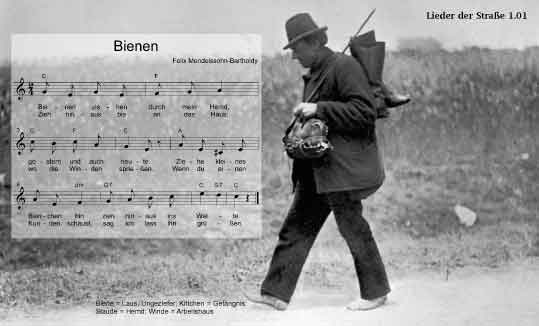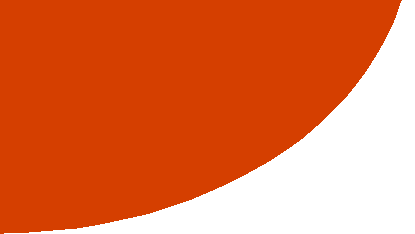„Lobhudeleien“
oder
„zur Sau gemacht“
Werner Hinze, Weißt du, wie viel
Sternlein stehen oder O, du Deutschland ich muss marschieren
Liedbiographien Bd. 5
Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs,
Band 49/2004
Münster/New York/München/ Berlin
2005
Schon der Titel des Heftes ist
irreführend, als es um das groß annoncierte
Kinderlied Weißt du, wie viel
Sternkin stehen (Wilhelm Hey 1837)
allenfalls am Rande geht. Im Zentrum steht vielmehr das
soldatische Abschiedslied O du
Deutschland, ich muß marschieren, nach dessen gängiger Melodie schließlich
auch das bekannte »Sternlein«-Lied gesungen wurde.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden, ist O du Deutsch-land, ich muß marschieren ursprünglich eines jener Soldatenlieder,
die den schmerzhaften Abschied von der Familie artikulieren.
Jenseits aufgesetzter Kriegsbegeisterung wird hier eher eine
Sehnsucht nach Friedenszeiten zum Ausdruck gebracht. Deshalb
hat Wolfgang Steinitz das Lied auch als ein »gegen
Söldnerdienst und Krieg« gerichtetes in seine
Sammlung Deutsche Volkslieder
demokratischen Charakters (1955)
aufgenommen. Steinitz war der erste Forscher, der darauf
aufmerksam machte, dass zu diesem Lied verschiedene Melodien in
der »Volksüberlieferung« vorkommen. Hier
knüpft Hinze an und erweitert das von Steinitz
vorgeschlagene Modell von drei Melodien auf sieben
Melodiegruppen, denen abgestuft wiederum verschiedene
Melodietypen zugeordnet werden. Die Basis dafür ist die
reichhaltige Quellenlage zu diesem Lied im Deutschen
Volksliedarchiv. Hinze wertet diese aus und macht dabei
anschaulich, welche Variantenvielfalt dieser Liedtyp im
melodischen Bereich wie auch auf der Ebene des Liedtextes
hervorgebracht hat.
Dieses vielfältige Material zur
Liedgeschichte wird vom Autor jedoch nur eingeschränkt
genutzt. Hinze beschränkt sich weitgehend auf eine
additive Beschreibung verschiedener Varianten und Motive. Ohne
historische Tiefenschärfe und analytische Impulse werden
dabei Bedeutung und Deutung dieses Liedes ebenso wenig
herausgearbeitet wie die verschiedenen Phasen seiner
Geschichte. Fragen zum sozialen Kontext spielen in dieser
»Liedbiographie« kaum eine Rolle, etwa zu seinem
offenkundigen Funktionswandel (vom Abschied des Soldaten hin
zum Abschied des Brautpaares bei Hochzeitsfeiern).
Überhaupt werden Aspekte der Rezeptionsgeschichte
allenfalls punktuell angedeutet. Um das Lied mit Hinze
»als aktives Antikriegslied einzustufen« (S. 17)
müsste jedenfalls überzeugenderes Material vorgelegt
werden. Auf der Basis vorliegender Darstellung bleiben solche
Interpretationen reines Wunschdenken (und eine Aushöhlung
des Begriffs des wirklich aktiven Antikriegsliedes).
Es handelt sich bei dieser Publikation
letztlich eher um essayistische Impressionen als um eine
wissenschaftlich solide Untersuchung zu diesem Lied. Zu
offenkundig treten hier Mängel zu Tage, sei es in
methodischer Hinsicht (Stilisierung von Einzelbelegen zu
»Melodietypen«), im wissenschaftlichen Arbeiten
(»Als F1 ist eine Arndtsche Variante einer Melodie
zugeordnet, die mir bekannt erscheint, aber deren Ursprung mir
nicht klar erinnerlich ist«, S. 14), bei musikbezogenen
Fragen (man stößt auf die offenbar ernst gemeinte
Behauptung, dass eine bestimmte »Melodie einen deutlich
süddeutschen Klang hat«, S. 15), bei fachlichen
Kenntnissen (der bekannte Volksliedforscher Ludwig Erk wird
beständig als Friedrich Erk bezeichnet, S. 14, 17, 43), in
formalen Dingen (es bleibt unklar, warum — entgegen der
sonstigen Praxis — bei den »Melodietypen« F1
bis F5b die Notenbeispiele nicht abgedruckt wurden), wie auch
in der Bewertung von Quellen: über die Sucher-Vertonung
wird gesagt, sie befinde sich »nur in wenigen, speziellen
Liederbüchern«, und dabei ignoriert, dass just diese
eine enorme Breitenwirkung hatten — zumal das Allgemeine Deutsche Kommersbuch — und beständige Neuauflagen zeitigten.
Welche Verbreitung die Silcherfassung im Bereich der
Männerchor-Literatur hatte, wurde offenbar gar nicht erst
geprüft - für den Autor steht ohnehin fest, dass
diese Vertonung »gänzlich ungeeignet« sei.
Aufs Ganze gesehen ist diese Broschüre eine vertane
Chance. Sie hätte zeigen können, wie interessant
liedmonografische Arbeiten sein können.
Eckhard John, Freiburg i.Br.
Tonsplitters Kommentar
Diese Kritik gehört eigentlich in die
Rubrik „sagt mehr über den Kritiker als über
das Objekt der Kritik“ doch wir können uns einen
Kommentar nicht verkneifen. Er kommt in Kürze: